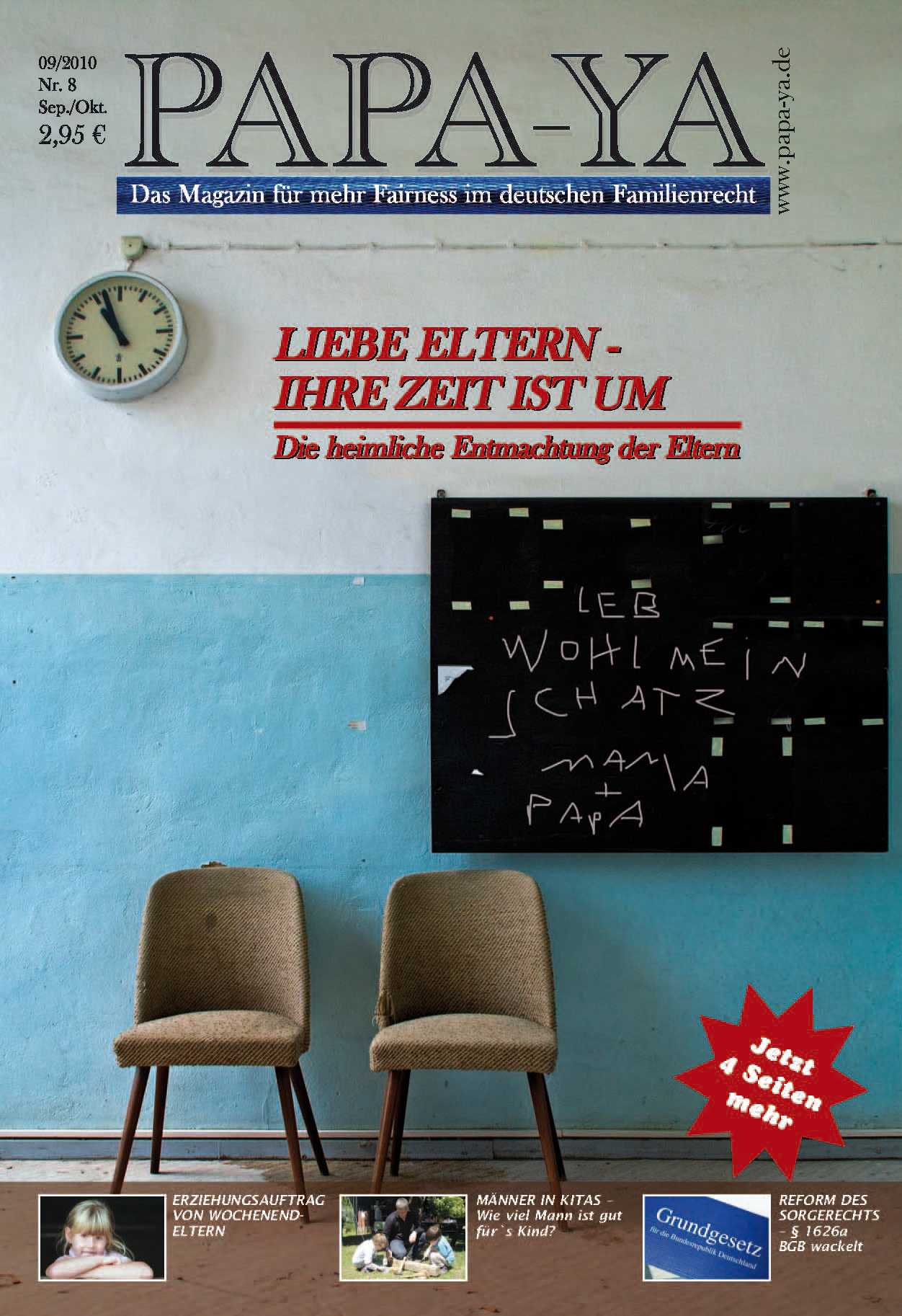| Gerichtsurteile aus dem Familienrecht |
Ungleichbehandlung von Ehe und eingetragener Lebenspartnerschaft im Erbschaftsteuer- und Schenkungsteuergesetz verfassungswidrig |
| veröffentlicht am 19. 08 2010 (jm) |
Bundesverfassungsgericht - Pressestelle - Pressemitteilung Nr. 63/2010 vom 17. August 2010 Beschluss vom 21. Juli 2010 – 1 BvR 611/07, 1 BvR 2464/07 – |
Nach den Bestimmungen der §§ 15, 16, 17 und 19 des Erbschaftsteuer- und Schenkungsteuergesetzes in der Fassung nach dem Jahressteuergesetz 1997 vom 20. Dezember 1996 (ErbStG a.F.) wurden eingetragene Lebenspartner nach Schaffung des Rechtsinstituts der Lebenspartnerschaft im Jahre 2001 erbschaftsteuerrechtlich erheblich höher belastet als Ehegatten. Während Ehegatten nach §§ 15 Abs. 1, 19 Abs. 1 ErbstG a.F. der günstigsten Steuerklasse I unterfielen und abhängig von der Höhe des Ererbten Steuersätze zwischen 7% und 30% zu entrichten hatten, waren Lebenspartner als „übrige Erwerber“ in die Steuerklasse III eingeordnet, die Steuersätze von 17 % bis zu 50 % vorsah. Zudem gewährte § 16 Abs. 1 Nr. 1 ErbStG a.F. Ehegatten einen persönlichen Freibetrag in Höhe von 600.000,- DM / 307.000,- € und § 17 Abs. 1 ErbStG a.F. einen besonderen Versorgungsfreibetrag in Höhe von 500.000,- DM / 256.000,- €. Eingetragenen Lebenspartnern stand demgegenüber aufgrund ihrer Einordnung in die Steuerklasse III lediglich ein Freibetrag in Höhe von 10.000,- DM / 5.200,- € zu (§ 16 Abs. 1 Nr. 5, § 15 Abs. 1 ErbStG a.F.). Von der Vergünstigung des Versorgungsfreibetrags waren sie gänzlich ausgeschlossen. Mit dem Erbschaftsteuerreformgesetz vom 24. Dezember 2008 sind die vorgenannten Vorschriften des Erbschaftsteuer- und Schenkungsteuergesetzes zu Gunsten von eingetragenen Lebenspartnern insoweit geändert worden, als der persönliche Freibetrag sowie auch der Versorgungsfreibetrag für erbende Lebenspartner und Ehegatten gleich bemessen werden. Allerdings werden eingetragene Lebenspartner weiterhin wie entfernte Verwandte und Fremde mit den höchsten Steuersätzen besteuert. Nach dem Gesetzentwurf der Bundesregierung zum Jahressteuergesetz 2010 vom 22. Juni 2010 ist eine vollständige Gleichstellung von Lebenspartnern und Ehegatten im Erbschaftsteuer- und Schenkungsteuerrecht – also auch in den Steuersätzen – beabsichtigt. Der Beschwerdeführer zu 1) ist Alleinerbe seines im August 2001 verstorbenen Lebenspartners; die Beschwerdeführerin zu 2) Erbin ihrer im Februar 2002 verstorbenen Lebenspartnerin. In beiden Fällen setzte das Finanzamt die Erbschaftsteuer nach einem Steuersatz der Steuerklasse III fest und gewährte den geringsten Freibetrag nach § 16 Abs. 1 Nr. 5 ErbStG a.F.. Die hiergegen erhobenen Klagen der Beschwerdeführer blieben vor den Finanzgerichten ohne Erfolg. Auf ihre Verfassungsbeschwerden hat der Erste Senat des Bundesverfassungsgerichts entschieden, dass die erbschaftsteuerrechtliche Schlechterstellung der eingetragenen Lebenspartner gegenüber den Ehegatten im persönlichen Freibetrag und im Steuersatz sowie durch ihre Nichtberücksichtigung im Versorgungsfreibetrag mit dem allgemeinen Gleichheitssatz (Art. 3 Abs. 1 GG) unvereinbar ist. Die Beschlüsse des Bundesfinanzhofs sind aufgehoben und die Sachen an diesen zur erneuten Entscheidung zurückverweisen worden. Der Gesetzgeber hat bis zum 31. Dezember 2010 eine Neuregelung für die vom Erbschaftsteuer- und Schenkungsteuergesetz a.F. betroffenen Altfälle zu treffen, die die Gleichheitsverstöße in dem Zeitraum zwischen dem Inkrafttreten des Gesetzes zur Beendigung der Diskriminierung gleichgeschlechtlicher Gemeinschaften vom 16. Februar 2001 bis zum Inkrafttreten des Erbschaftsteuerreformgesetz vom 24. Dezember 2008 beseitigt. Der Entscheidung liegen im Wesentlichen folgende Erwägungen zugrunde: Für die Schlechterstellung der eingetragenen Lebenspartner gegenüber den Ehegatten bestehen keine Unterschiede von solchem Gewicht, dass sie die Benachteiligung der Lebenspartner im Erbschaftsteuer- und Schenkungsteuergesetz in der Fassung nach dem Jahressteuergesetz 1997 rechtfertigen könnten. Dies gilt für den persönlichen Freibetrag nach § 16 ErbStG a.F. ebenso wie für den Versorgungsfreibetrag nach § 17 ErbStG a.F. und den Steuersatz nach § 19 ErbStG a.F.. Die Privilegierung der Ehegatten gegenüber den Lebenspartnern im Recht des persönlichen Freibetrags lässt sich nicht allein mit Verweisung auf den besonderen staatlichen Schutz von Ehe und Familie (Art. 6 Abs. 1 GG) rechtfertigen. Geht die Förderung der Ehe mit einer Benachteiligung anderer Lebensformen einher, obgleich diese nach dem geregelten Lebenssachverhalt und den mit der Normierung verfolgten Zielen der Ehe vergleichbar sind, rechtfertigt die bloße Verweisung auf das Schutzgebot der Ehe eine solche Differenzierung nicht. Die Befugnisse des Staates, in Erfüllung seiner grundgesetzlichen Schutzpflicht aus Art. 6 Abs. 1 GG für Ehe und Familie tätig zu werden, bleiben also gänzlich unberührt von der Frage, inwieweit Dritte etwaige Gleichbehandlungsansprüche geltend machen können. Allein der Gleichheitssatz (Art. 3 Abs. 1 GG) entscheidet nach Maßgabe der vom Bundesverfassungsgericht hierzu entwickelten Anwendungsgrundsätze darüber, ob und inwieweit Dritten, wie hier den eingetragenen Lebenspartnern, ein Anspruch auf Gleichbehandlung mit einer gesetzlichen oder tatsächlichen Förderung von Ehegatten und Familienangehörigen zukommt. Die unterschiedliche Freibetragsregelung ist nicht aufgrund einer höheren Leistungsfähigkeit erbender Lebenspartner gerechtfertigt. Soweit zur Begründung des hohen Freibetrags für Ehegatten und Kinder angeführt wird, dass diese aufgrund ihres besonderen Näheverhältnisses und ihrer wirtschaftlichen Beziehung zum Erblasser durch den Erbfall weniger leistungsfähig seien, als es der nominale Wert des Erbes erwarten ließe, gelten die dem zugrunde liegenden Erwägungen ebenso für eingetragene Lebenspartner. Diese leben wie Ehegatten in einer auf Dauer angelegten, rechtlich verfestigten Partnerschaft. Auch sie partizipieren bereits zu Lebzeiten am Vermögen ihres eingetragenen Lebenspartners und erwarten, den gemeinsamen Lebensstandard im Falle des Todes eines Lebenspartners halten zu können. Sofern dem Erhalt der Erbschaft durch den Freibetrag für Ehegatten unterhaltsersetzende Funktion sowie eine Versorgungswirkung zukommt, gilt dies auch für Lebenspartner, die nach der schon für die Ausgangsverfahren maßgebenden Rechtslage einander zu „angemessenem Unterhalt“ verpflichtet sind. Das das Erbschaftsteuerrecht prägende Familienprinzip vermag die Schlechterstellung der eingetragenen Lebenspartner gegenüber den Ehegatten hinsichtlich des persönlichen Freibetrags ebenfalls nicht zu rechtfertigen. Wie die Ehe ist die eingetragene Lebenspartnerschaft auf Dauer angelegt, rechtlich verfestigt und begründet eine gegenseitige Unterhalts- und Einstandspflicht. Die Ungleichbehandlung ist auch nicht dadurch legitimiert, dass grundsätzlich nur aus einer Ehe gemeinsame Kinder hervorgehen können und der Gesetzgeber unter Anknüpfung an das Familienprinzip eine möglichst ungeschmälerte Erhaltung kleiner und mittlerer Vermögen in der Generationenfolge erhalten möchte. In ihrer Eignung als Ausgangspunkt der Generationenfolge unterscheidet sich die Ehe zwar grundsätzlich von der Lebenspartnerschaft, da aus der Beziehung gleichgeschlechtlicher Paare grundsätzlich keine gemeinsamen Kinder hervorgehen können. Dieser Gesichtspunkt kann jedoch nicht als Grundlage einer unterschiedlichen Behandlung von Ehegatten und Lebenspartnern herangezogen werden, da er in der gesetzlichen Regelung nicht hinreichend umgesetzt ist. Denn das geltende Recht macht - im Unterschied zu früheren Regelungen - die Privilegierung der Ehe bzw. die Höhe des Freibetrags für Ehegatten gerade nicht vom Vorhandensein gemeinsamer Kinder abhängig. Für die gänzliche Nichtberücksichtigung der Lebenspartner beim Versorgungsfreibetrag nach § 17 ErbStG a.F. fehlt ebenfalls ein ausreichender Differenzierungsgrund. Der Versorgungsfreibetrag dient in erster Linie dazu, die unterschiedliche erbschaftsteuerrechtliche Behandlung gesetzlicher und vertraglicher Versorgungsbezüge auszugleichen, und soll insofern eine nicht ausreichende Versorgung des überlebenden Ehegatten mit steuerfreien Versorgungsbezügen kompensieren. Dieses gesetzgeberische Ziel besitzt in gleicher Weise für Lebenspartner Gültigkeit. Im Übrigen gelten auch hier die vorgenannten Erwägungen. Schließlich findet sich kein hinreichender Unterscheidungsgrund dafür, dass eingetragene Lebenspartner der Steuerklasse III mit den höchsten Steuersätzen, Ehegatten hingegen der Steuerklasse I mit den niedrigsten Steuersätzen zugewiesen werden (§ 15 Abs. 1, § 19 Abs. 1 ErbStG a.F.). Wie beim persönlichen Freibetrag so gilt auch hier, dass die Unterschiede zwischen der Ehe und der Lebenspartnerschaft im derzeitigen Regelungskonzept keine Schlechterstellung der Lebenspartner in der Steuerklasseneinteilung tragen.
Geschiedene Mutter muss sich notfalls neuen Arbeitsplatz suchen |
| veröffentlicht am 13. 08 2010 (jm) |
31.05.2010 | dpa
|
| Volle Anrechung des Kindergelds auf "Hartz IV-Leistungen" verfassungsgemäß |
| veröffentlicht 24. Mai 2010 (jm) |
|
Bundesverfassungsgericht - Pressestelle - |
| Nachnamen des Kindes: Änderung nach Ehescheidung |
| veröffentlicht 02. Juli 2009 |
|
Wenn eine Mutter nach der Scheidung ihren Geburtsnamen wieder führt, so kann unter Umständen auch ihr Kind diesen Geburtsnamen annehmen. Die angestrebte Namensänderung muss dem Kindeswohl dienen: Eine Deutsche war mit einem Iraner verheiratet. Aus der Ehe ging ein gemeinsames Kind hervor. Nach Scheidung der Ehe lebte das Kind weiter bei der Mutter. Nachdem die Mutter ihren Geburtsnamen wieder angenommen hatte, sollte in der Folge auch das Kind diesen Geburtsnamen der Mutter erhalten. Die Hansestadt Lübeck entsprach dem Antrag der Mutter auf Anpassung des Nachnamens des Kindes an ihren Geburtsnamen. Dagegen wehrte sich der iranische Vater. Das Verwaltungsgericht Schleswig bestätigte die Entscheidung der Verwaltung zugunsten der Mutter. Die Voraussetzungen für eine Namensänderung lägen vor. Zwar reiche es regelmäßig nicht, wenn eine Namensänderung nur dazu dienen solle, dem Kind bloße Unannehmlichkeiten zu ersparen, die sich aus einer Namensverschiedenheit zum sorgeberechtigten Elternteil ergäben. Hier hatte der Sohn allerdings glaubhaft dargelegt, dass er sich mit dem Namen seines Vaters nicht identifizieren könne. Der Sohn wies darauf hin, dass sich sein Vater nicht um ihn kümmere, bereits seit 10 Jahren habe er ihn nicht mehr gesehen. Es gäbe ferner Schwierigkeiten bei der Schreibweise des ausländischen Namens. Vor allem habe er im Alltag mit der Voreingenommenheit gegenüber Personen islamischer Herkunft zu kämpfen. Im Übrigen sei er der einzige in seiner Familie mit einem anderen Nachnamen. Das Gericht sah darin einen wichtigen Grund für die beantragte Namensänderung und bestätigte die Entscheidung der Verwaltung. Verwaltungsgericht Schleswig, Urteil vom 18.03.2009, 14 A 167/07 Dr. Ernst L. Schwarz Quelle: www.mein-familienrecht.de |
| Kind darf nicht wie Stiefvater heißen |
| veröffentlicht am 08. Juni 2009 |
|
Ein Kind hat zu seinem leiblichen Vater keinen Kontakt mehr, lebt bei der Mutter und seinem Stiefvater - und möchte dessen Namen annehmen. Dieser Wunsch wurde einer betroffenen Familie nun jedoch vom Oberlandesgericht versagt. Koblenz - Das Oberlandesgericht (OLG) Koblenz gab der Beschwerde eines Vaters gegen eine Entscheidung des Amtsgerichts Trier statt. Der Mann hatte sich dagegen gewandt, dass sein leibliches Kind den Namen seines Stiefvaters angenommen hatte. Das berichtet die Fachzeitschrift "OLG-Report". Das Kind lebt in der neuen Familie seiner Mutter und hat derzeit zu seinem leiblichen Vater keinen Kontakt. Anders als das Amtsgericht sah das OLG darin noch keinen ausreichenden Grund dafür, dass die Namensänderung auch tatsächlich dem Wohl des Kindes entspreche. Die Kontinuität der Namensführung sei ein Aspekt, der weit über das Kindesalter hinaus reiche. So sei es nicht ausgeschlossen, dass der leibliche Vater und das Kind in späteren Jahren wieder Kontakt zueinander aufnehmen würden. Der Wunsch eines Kindes, den Namen seines Stiefvaters anzunehmen, rechtfertigt demnach keine Namensänderung. Zwar ist nach Meinung der Richter das Wohl des Kindes maßgebend. Es dürfe aber nicht allein aus der aktuellen familiären Situation des Kindes, sondern müsse langfristig beurteilt werden. Az.: 9 UF 116/08 |